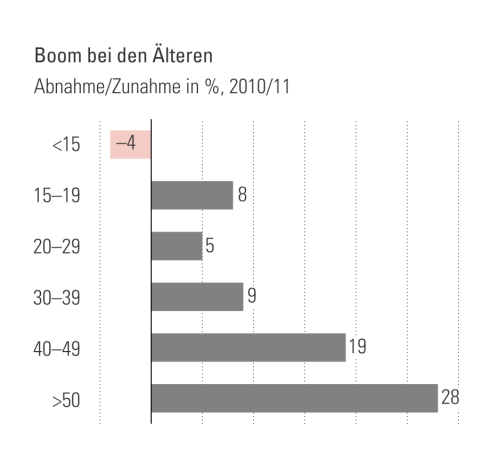In meinen bisherigen Blogbeiträgen habe ich mich hauptsächlich mit dem Einsatz von ICT bzw. Social Media im Unterricht auseinander gesetzt. In diesem letzten Beitrag möchte ich den Fokus verändern und das Thema Social Media im Rahmen meines Unterrichtsfaches Wirtschaft und Recht anschauen. Anlass dazu ist ein Artikel in der NZZ-Beilage Equity vom 22. März 2012. Im Artikel „Soziale Netzwerke für sich nutzen“ wird thematisiert, wie in der Schweiz kleine und mittelständische Betriebe die Social Media nutzen. Eine Umfrage der ZHAW unter 419 Betrieben hat ergeben, dass 56% der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) mit weniger als 250 Mitarbeitenden in den sozialen Netzwerken aktiv sind. Von den grossen Konzernen (über 250 Mitarbeitende) nutzen hingegen praktisch alle, nämlich 96%, die Möglichkeiten von Facebook, Youtube und Co. Als Haupthindernis erwähnen die KMU den grossen Aufwand, der nötig sei, um eine regelmässige „Betreuung der Seiten“ zu gewährleisten. Im NZZ-Artikel werden zwei (KMU-)Betriebe beschrieben, die bereits heute eine sehr aktive Rolle in den sozialen Netzwerken spielen. Vielleicht ist es kein Zufall, dass beide Betriebe in der Velobranche zu Hause sind? Sowohl in Thömus Veloshop als auch bei Veloplus gibt es einen Hauptverantwortlichen für die Umsetzung der Strategie in den sozialen Medien. Und offenbar kann diese Aufgabe sowohl von einem Digital Native als auch von einem Digital Immigrant mit Erfolg umgesetzt werden. (Sie wissen nicht, was ein Digital Native bzw. ein Digital Immigrant ist? Dann lesen Sie einfach meinen Beitrag „Die Parallelwelt der Digital Natives„.) Wie nutzen diese beiden Betriebe die sozialen Medien? Auf klassische Art und Weise, indem sie aktuelle Fotos von Veranstaltungen ins Facebook stellen und über ihre neuen Produkte berichten. Zudem stellt Veloplus Anleitungen auf Youtube, die den Kunden helfen sollen, ihre Produkte korrekt zu nutzen.
Was hat dies alles mit meinem konkreten Unterricht zu tun? Ich stelle mir vor, dass diese Informationen für die Lernenden von Interesse sind, wenn sie sich mit dem Thema Marketing beschäftigen. Und warum sollen sie beim nächsten Auftrag nicht – anstelle eines herkömmlichen Marketing-Mix – eine um die sozialen Medien erweiterte Variante erarbeiten?